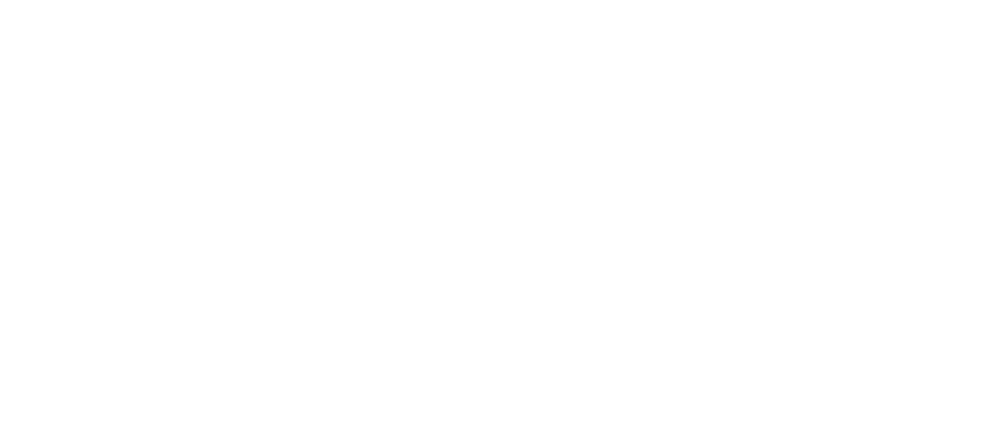Das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) vom 18. Juni 2025 (Az: X R 19/21) markiert einen Wendepunkt in der steuerlichen Schätzungspraxis. Erstmals äußert der BFH „erhebliche Zweifel“ an der Eignung der amtlichen Richtsatzsammlung als Grundlage für Schätzungen und stellt damit ein seit Jahrzehnten etabliertes Instrument der Betriebsprüfung grundlegend in Frage.
Der Fall: Diskothek vs. Gaststätte
Der konkrete Fall betraf eine Hamburger Diskothek, deren Betriebseinnahmen aufgrund mangelhafter Kassenführung geschätzt wurden. Das Finanzgericht Hamburg hatte in seiner Entscheidung einen Rohgewinnaufschlagsatz von 300 % auf Basis der Richtsätze für Gaststätten angesetzt. Der BFH hob diese Entscheidung jedoch auf, da die vom FG vorgenommene Hinzuschätzung auf der Grundlage eines äußeren Betriebsvergleichs und unter Berücksichtigung eines Rohgewinnaufschlagsatzes von 300 % nicht nachvollziehbar begründet worden war. In seinem Urteil äußerte sich der BFH sodann auch zu grundsätzlichen Erwägungen im Rahmen der Schätzung durch äußeren Betriebsvergleich.
Äußerer und innerer Betriebsvergleich
Der BFH stellt klar: Innerer Betriebsvergleich vor äußerem Betriebsvergleich.
Bei mehreren in Betracht kommenden Schätzungsmethoden sind „tendenziell ungenauere Schätzungsmethoden gegenüber genaueren Schätzungsmethoden nachrangig“. Eine Nachkalkulation auf Basis des Wareneinsatzes sei daher grundsätzlich einer Richtsatzschätzung vorzuziehen, denn eine solche biete als die zuverlässigere Schätzungsmethode offensichtlich die größere Gewähr dafür, mit zumutbarem Aufwand das wahrscheinlichere Betriebsergebnis zu erzielen.
Kritik an der Richtsatzsammlung
Der BFH kritisiert die mangelnde statistische Repräsentativität der Richtsatzsammlung.
Das Hauptproblem bestehe darin, dass die Daten nicht auf einer echten Zufallsstichprobe basierten, sondern auf Betrieben, die nach den Kriterien des § 193 AO zur Außenprüfung ausgewählt wurden. Dies führe zu einer systematischen Verzerrung („selection bias“).
Problematisch sei insbesondere, dass:
- nur „prüfungswürdige“ und „geeignete Normalbetriebe“ in die Richtsatzsammlung einfließen würden,
- Verlustbetriebe grundsätzlich ausgeschlossen würden,
- die 10 % der Betriebe mit den höchsten und niedrigsten Werten werden zusätzlich nicht berücksichtigt würden und
- eine exakte Beschreibung des Auswahlverfahrens fehlen würde.
Auch die sehr weiten Spannen innerhalb der Gewerbeklassen seien ein zentrales Problem. Beispielhaft wies der BFH die Spannen der Rohgewinnaufschlagsätze für folgende Gewerbeklassen aus:
- Hotels, Gasthöfe und Pensionen: 257 % bis 1.329 %,
- Kosmetiksalons: 150 % bis 1.011 %,
- Telekommunikation: 43 % bis 1.900 %.
Bei solchen Spannen sei eine nachvollziehbare Begründung für den konkret gewählten Wert zwingend erforderlich. Es müsse erkennbar und nachvollziehbar sein, dass das Finanzgericht die Besonderheiten des Einzelfalls in den Blick genommen hat.
Selbst bei einer „tauglichen“ Richtsatzsammlung lägen lediglich 70 von 100 Betrieben im Richtsatzrahmen – die anderen 30 % sind „Ausreißer“. Dies unterstreiche die Ungenauigkeit der Schätzungsmethode.
Praktische Konsequenzen
Für die Praxis stellt sich deshalb die Frage, wann und in welchem Rahmen die Richtsatzschätzung noch zulässig ist.
Der BFH sieht den äußeren Betriebsvergleich zwar nach wie vor als notwendige – wenn auch nachrangige – Schätzungsmethode. Finanzämter und Finanzgerichte hätten künftig allerdings nachvollziehbar darzulegen, wie sie ihre Überzeugung gewonnen haben und dass die Überzeugungsbildung in rechtlich zulässiger und einwandfreier Weise zustande gekommen ist.
Eine fehlende oder nicht nachvollziehbare Begründung könne zu einem sachlich-rechtlichen Mangel des Urteils führen.
Für die Richtsatzschätzung blieben nach Ansicht des BFH nur noch solche Betriebe, bei denen die Aufzeichnungen derart lückenhaft oder inhaltlich zweifelhaft sind, dass sie bei zumutbarem Aufwand noch als Grundlage für einen – auch mit Restunsicherheiten behafteten – inneren Betriebsvergleich ausscheiden.
Künftig sollten Finanzämter und Gerichte bei Anwendung der Mittelsätze aus den Richtsatzsammlungen nach Ansicht des BFH deshalb zweistufig vorgehen:
- In einem ersten Schritt sollte die weite Spanne der Rahmensätze unter Heranziehung der tatsächlichen Verhältnisse des zu schätzenden Betriebs (zum Beispiel Lage in einem Hochpreis- oder Niedrigpreisgebiet, Kundenkreis, sonstige Besonderheiten) zu einem schmaleren, im konkreten Streitfall in Betracht kommenden Bereich verengt werden.
- In einem zweiten Schritt muss der Rechtsanwender sich dann auf einen bestimmten, nachvollziehbar begründbaren Wert aus dieser verengten Spanne festlegen.
Zudem sollten die örtlichen Verhältnisse und auch die Zielgruppe berücksichtigt werden.
Fazit: Ein Paradigmenwechsel
Das BFH-Urteil bedeutet nicht das Ende der Richtsatzschätzung, wohl aber das Ende ihrer unreflektierten Anwendung. Die Rechtsprechung fordert eine methodisch saubere, gut begründete Schätzungspraxis, die dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspricht. Für die Finanzverwaltung bedeutet dieses Urteil die Herausforderung, die Richtsatzsammlung grundlegend zu überarbeiten oder alternative Schätzungsinstrumente zu entwickeln, die den statistischen Anforderungen genügen.
Für die Praxis gilt: Die Zeiten pauschaler Richtsatzanwendungen sind vorbei. Künftig müssen Schätzungen den strengen Maßstäben wissenschaftlicher Methodik standhalten. Für den Steuerpflichtigen und seine Berater ist die Entscheidung des BFH jedenfalls ein Gewinn.
Für unsere Beratungspraxis ändert sich durch die Entscheidung allerdings kaum etwas, da wir ohnehin bereits seit jeher auf Basis einer zweifelhaften Richtsatzsammlung argumentiert und diese kritisch hinterfragt haben.