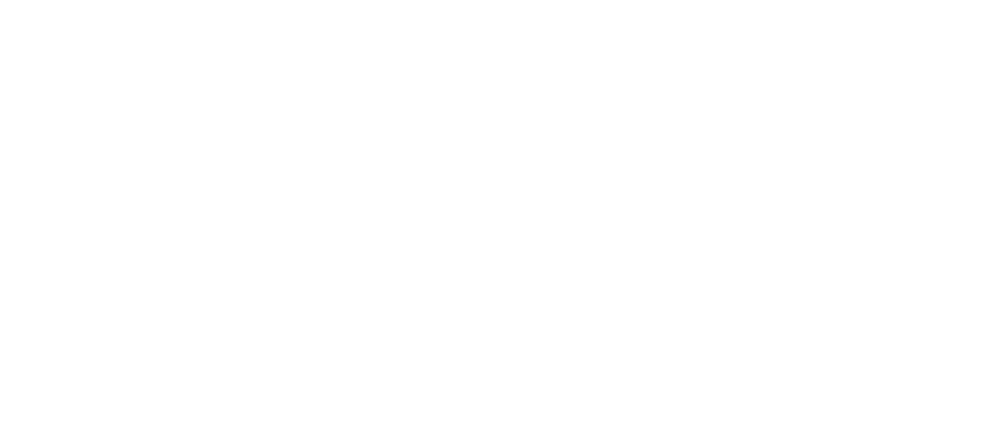Es war nur eine Frage der Zeit, wann das Bundesverfassungsgericht dazu aufgerufen sein würde, sich zur Frage zu äußern, unter welchen Voraussetzungen in Zeiten des grassierenden Corona-Virus Hauptverhandlungen in Strafsachen noch stattfinden können und dürfen.
Am 16.11.2020 ist dies nun erfolgt, wobei die 2. Kammer des 2. Senats des Bundesverfassungsgerichts im Hinblick auf ein beim Landgericht Bonn anstehendes Strafverfahren im sog. Cum-Ex-Komplex einstimmig beschlossen hat, dem Antrag des dort Beschuldigten, im Wege der einstweiligen Anordnung, die am 17.11.2020 beginnenden Hauptverhandlungstermine aufzuheben und das Verfahren vorläufig auszusetzen, bzw. hilfsweise anzuordnen, dass die Verhandlungstermine im November 2020 aufgehoben werden, nicht entsprochen hat.
Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (2 BvQ 87/20) war – leider – erwartbar. Nicht unbedingt erwartbar war jedoch, mit welcher Kälte das Bundesverfassungsgericht den Belangen des staatlichen Strafanspruchs den Vorrang vor anderen Rechtspositionen eingeräumt hat. Die Entscheidung ist auch insofern unbedingt lesenswert und wird möglicherweise auch für zukünftige Generationen eine interessante Fundstelle sein, wenn die Frage untersucht wird, wie es zu Zeiten des Corona-Virus um den gelebten Humanismus eigentlich tatsächlich bestellt war.
1.
Der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts lag der Antrag eines 77 Jahre alten Beschuldigten eines Strafverfahrens zugrunde, der aufgrund erheblicher Vorschädigungen seiner Lunge einschließlich Entfernung eines Lungenoberlappens aufgrund dauerhaft verringerter Nierenfunktion, leichten Bluthochdrucks und der Autoimmunerkrankung Morbus Basedow und daraus resultierender krankhafter Schilddrüsenüberfunktion und blasenbildender Hauterkrankung gesundheitlich erheblich beeinträchtigt war. In seiner Gehfähigkeit war der Antragsteller zudem Arthrose-bedingt eingeschränkt und im Jahre 2012 an Darmkrebs erkrankt, wobei der Tumor komplett entfernt werden konnte. Der deshalb zu einer Risikogruppe gehörende Beschuldigte hatte bei der zuständigen Strafkammer des Landgerichts Bonn auf diese Problematik hingewiesen, wobei die Strafkammer hierauf allerdings dergestalt reagiert hatte, dass sie das Verfahren des Antragstellers vom Verfahren gegen vier weitere Angeklagte abtrennte und beschloss, das Verfahren gegen den Antragsteller vorzuziehen. Nachdem sodann durch den Kammervorsitzenden der zuständigen Strafkammer Termin zur Hauptverhandlung auf den 17.11.2020 und weitere Termine zur Fortsetzung der Hauptverhandlung bis Anfang Januar 2021 bestimmt worden waren, war vom Antragsteller dessen erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigung gegenüber dem Gericht thematisiert worden. Dabei wurde auch insbesondere angesprochen, dass weder Verjährung drohe noch eine Haftsache vorliege und auch sonst keine besondere Dringlichkeit erkennbar sei, die es geboten erscheinen lasse, dem Antragsteller das Risiko einer mehrstündigen Reise zum Gericht aufzubürden. Dabei sei auch zu bedenken, dass die Hausärztin des Antragstellers diesem attestiert habe, dass er aufgrund seines Alters und seiner Vorerkrankungen zu der Patientengruppe gehöre, bei der im Falle einer COVID-19-Erkrankung mit einem schweren Verlauf zu rechnen habe. Es bestehe sogar das Risiko, dass eine Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus für ihn tödlich ende.
Im Gegensatz zur zuständigen Staatsanwaltschaft Köln, die die Argumente des Antragstellers als „beachtenswert“ und eine Verlegung der Hauptverhandlung und eine Terminierung, die sich an der Infektionslage orientiere, als vertretbar erachtete, verfing die Argumentation beim Landgericht jedoch nicht. Das Landgericht ordnete vielmehr eine Untersuchung des Antragstellers durch einen rechtsmedizinischen Sachverständigen im Hinblick auf dessen Verhandlungsfähigkeit an, wobei der Sachverständige sich in seinem Gutachten auch zur Frage des erhöhten Risikos einer schweren Erkrankung beim Angeklagten verhalten sollte und ob geeignete Vorsichtsmaßnahmen das Infektionsrisiko erheblich verringern könnten. Zudem wollte das Gericht ausdrücklich wissen, ob eine naheliegende und konkrete Gefahr bestünde, dass der Antragsteller bei Durchführung der Hauptverhandlung schwerwiegenden Schaden an seiner Gesundheit nehmen würde.
Der beauftragte Rechtsmediziner kam im Rahmen seiner Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die Lungentuberkulose beim Antragsteller ausgeheilt sei und im Jahr 2019 keine wesentlichen Einschränkungen der Lungenfunktion festzustellen seien. Insbesondere bestünden deshalb keine Einschränkungen beim Atmen, auch nicht, wenn der Antragsteller eine Maske trage. Im Hinblick auf die Pandemielage sei zu unterscheiden zwischen dem Risiko, sich mit dem neuartigen Corona-Virus zu infizieren, und dem Risiko, das mit einer Infektion einhergehe. Allgemein sei darauf zu verweisen, dass in der derzeitigen Lockdown-Situation die Ansteckungsgefahr reduziert sei.
Es stehe zu befürchten, dass es nach dem Ende des Lockdowns zu einem neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen komme. Von daher gehe eine Terminierung Mitte/Ende November vermutlich mit einem geringeren Risiko her als eine in absehbarer Zeit terminierte spätere Verhandlung (vgl. zu den weitere Einzelheiten BVerfG a. a. O., Rn. 11 ff.).
Die aufgestellten Hygieneregeln müssten allerdings mit besonderer Strenge befolgt werden. Problematisch im Hinblick auf eine mögliche Infektionsgefährdung sei darüber hinausgehend weniger der Aufenthalt im Gerichtssaal als die An- und Abreise zum Gerichtsort.
„Sollte der Antragsteller nicht mehr selbst in der Lage sein, längere Strecken mit einem Kraftfahrzeug zu fahren, sei ihm ein Fahrer aus dem Familienkreis zu empfehlen … Risikoärmer als zahlreiche Fahrten zu der Gerichtsverhandlung wäre eine Unterbringung vor Ort. Sichergestellt werden sollte aber die Versorgung durch einen Lieferservice, um Außenkontakte weitgehend zu vermeiden.“ (BVerfG a. a. O, Rn. 15).
Diesem Gutachten des Sachverständigen folgte das Landgericht Bonn mit einer Ablehnungsentscheidung, die sodann Gegenstand der auf eine Verletzung von Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG gestützten, letztlich erfolglosen Verfassungsbeschwerde war.
2.
Erwartbar und im üblichen Rahmen bewegt sich dabei die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts bei der Frage der Zulässigkeit. So ist das Bundesverfassungsgericht von einer Unzulässigkeit des Antrags wegen fehlender Rechtswegerschöpfung ausgegangen. Dem Antragsteller wurde dabei vorgehalten, dass er vor einer Anrufung des Bundesverfassungsgerichts erst den Rechtsbehelf der Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts hätte einlegen müssen. Zwar sei gemäß § 305 Abs. 1 StPO die Erhebung der Beschwerde gegen Terminbestimmungen grundsätzlich nicht statthaft. Dies gelte allerdings dann nicht, wenn der Angriff sich darauf richte, dass das Gericht das ihm zustehende Ermessen bei der Terminsanordnung fehlerhaft ausgeübt habe und deshalb die Terminsanordnung rechtswidrig sei. Denn darin liege eine besondere selbstständige Beschwer, der § 305 Abs. 1 StPO nicht entgegenstünde.
3.
Beklemmender ist hingegen, mit welchen Erwägungen das Bundesverfassungsgericht den Antragsteller inhaltlich verbeschieden hat. Zwar sieht das Bundesverfassungsgericht grundsätzlich auch das bestehende Spannungsverhältnis zwischen der Verpflichtung des Staates zur Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs und dem Grundrecht auf Gesundheit und Leben, wobei aber lediglich eine naheliegende konkrete Gefahr, dass der Beschuldigte bei Durchführung der Hauptverhandlung sein Leben einbüßen oder schwerwiegenden Schaden an seiner Gesundheit nehmen würde, der Fortsetzung eines Strafverfahrens aus grundrechtlichen Erwägungen entgegenstehen soll. Die reine Möglichkeit, dass dies erfolgen könne, sei nicht ausreichend, wobei die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit des Schadenseintritts jedoch nicht überspannt werden dürften. Ob dies vom Landgericht richtig eingeschätzt worden sei, sei allerdings für das Bundesverfassungsgericht nur beschränkt prüfungsfähig. Denn dem (Tat)-Gericht käme bei der Erfüllung seiner Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ein erheblicher Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu.
Danach sei es aber nachvollziehbar und verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Landgericht davon ausgehe, dass beim Antragsteller gegenwärtig kein akutes Krankheitsbild vorläge, welches die Annahme einer Verhandlungsunfähigkeit rechtfertigen könnte.
Im Hinblick auf die Gefährdungslage durch die COVID-19-Pandemie sei auch die Annahme nicht zu beanstanden, dass der Antragsteller kein im Vergleich zur Allgemeinheit höheres Risiko einer Ansteckung habe. Insbesondere sei nicht zu beanstanden, dass die Kammer annehme, dass es dem Antragsteller möglich sei, „geeignete Schutzmaßnahmen zu ergreifen, insbesondere ausreichend Schutz bietende Masken zu tragen“.
Ebenso unproblematisch sieht das Bundesverfassungsgericht den Umstand, dass beim Antragsteller im Falle einer Infektion ein wesentlich erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf einer COVID-19-Erkrankung bestünde. Denn „die Möglichkeit, dass ein Beschuldigter der Belastung einer Hauptverhandlung nicht gewachsen ist, (lasse sich) letztlich niemals ausschließen“.
Darüber hinausgehend hält das Bundesverfassungsgericht nach seinem eingeschränkten Prüfungsmaßstab das Hygienekonzept des Gerichts für tragfähig und sieht schlussendlich auch keine verfassungsrechtlichen Bedenken in dem Hinweis der Strafkammer, dass es für die Kammer nur entscheidend sei, ob es für den Antragsteller zumutbare Wege gäbe, den Gerichtsort zu erreichen, ohne sich einem unvertretbaren Ansteckungsrisiko auszusetzen. Dabei führt das Bundesverfassungsgericht schließlich auch noch an, dass der Antragsteller nicht dargelegt habe, dass ihm „Fahrten zum Verhandlungsort unter Einhaltung der dargelegten Schutzvorkehrungen weder möglich noch zumutbar sind sowie … die Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit dort kurzfristig Unterkunft zu finden. Soweit der Antragsteller auf das bei jeder Reise immanente Risiko einer Ansteckung verweist, stellt er wiederum auf den Ausschluss eines jeden Ansteckungsrisikos ab, die verfassungsrechtlich nicht geboten ist“.
4.
Die dargestellte Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts wirft in ihrer Begründung eine Vielzahl von Fragen auf und es bleibt zu hoffen, dass sie auch in rechtsethischer Hinsicht zur Diskussion Anlass geben wird. Interessant ist bereits der gedankliche Ansatz, dass die Gerichte ausgerechnet den Zeitpunkt, zu dem durch gesteigerte rigide Maßnahmen aufgrund erhöhter Infektionszahlen mit sanktionsbewehrten Beschränkungen auf weniger soziale Kontakte hingewirkt werden soll (Bayern hat aktuell sogar den Katastrophenfall ausgerufen), als einen günstigeren Zeitpunkt zur Durchführung einer Hauptverhandlung im Vergleich zu anderen Zeitpunkten sehen. Ein Widerspruch könnte kaum offensichtlicher sein.
Genau genommen liegen sogar gleich zwei Denkfehler vor:
Zum einen stagniert in Folge des Lockdowns bestenfalls die Zahl der Neuansteckungen. Die Ansteckungsgefahr ist also keinesfalls reduziert. Zum anderen ist die Ansteckungsgefahr auch nur für die reduziert, die in den Schutzbereich des Lockdowns fallen. Und dies verwehren die Gerichte nun gerade den Beschuldigten.
Besonders bemerkenswert ist darüber hinausgehend auch der Gedanke einer Wohnsitzbegründungspflicht am Ort des Gerichts für die Dauer einer möglicherweise länger andauernden Hauptverhandlung. Und schließlich ist auch noch der demonstrative Optimismus, dass Hygieneregeln in Gerichtssälen signifikant ansteckungsmindernd wirken könnten, bemerkenswert. Wer, wie der Unterzeichner, in diesen Zeiten Hauptverhandlungen in Gerichtssälen unter Corona-Bedingungen mit all ihren logischen Brüchen und Widersprüchlichkeiten erlebt hat und erleben muss, wird sich schwertun, diesen Optimismus zu teilen.

Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht